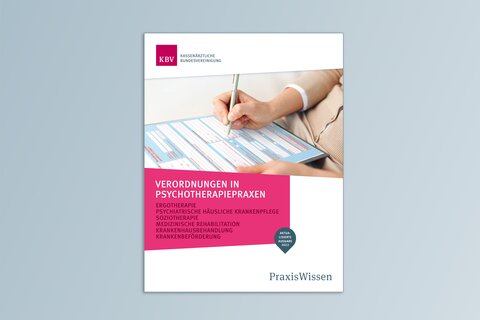Medizinische Rehabilitation

Versicherte haben Anspruch auf Leistungen zur medizinischen Rehabilitation. Das Ziel besteht darin, eine Behinderung oder Pflegebedürftigkeit abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder ihre Folgen zu mildern.
Die Krankenkassen übernehmen die Kosten, wenn keine Verminderung der Erwerbstätigkeit vorliegt oder droht, wenn kein Arbeitsunfall und keine Berufskrankheit vorliegt, für Altersrentner, für Mütter und Väter, wenn es sich nicht um eine reine Vorsorge handelt, sondern eine Beeinträchtigung vorliegt und deshalb eine Rehabilitation erforderlich ist, sowie für Kinder und Jugendliche, wenn dies medizinisch notwendig ist.
Bei Menschen im erwerbsfähigen Alter ist die Rentenversicherung der zuständige Kostenträger.
Das leistet Reha
Die Übersicht zeigt, welche Schwerpunkte und Behandlungsmöglichkeiten es bei der medizinischen Rehabilitation gibt und wo diese durchgeführt werden – unabhängig davon, wer die Kosten trägt.
Verordnungsbefugnis
Alle Ärztinnen und Ärzte dürfen eine medizinische Rehabilitation verordnen. Ein zusätzlicher Qualifikationsnachweis ist nicht erforderlich. Auch Psychologische Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeuten dürfen eine Verordnung ausstellen – allerdings mit der Beschränkung auf psychosomatische Rehabilitation und Rehabilitation für psychisch kranke Menschen.
Medizinische Rehabilitation kann in der Videosprechstunde verordnet werden, wenn die Praxis den Patienten kennt. Die konkreten Funktionseinschränkungen müssen bekannt sein und die gegebenenfalls erforderlichen Funktionstests durchgeführt worden sein. Wurden alle verordnungsrelevanten Informationen erhoben, kann die Veranlassung einer medizinischen Rehabilitation in der Videosprechstunde erfolgen.
Die Voraussetzungen und das Verfahren der Verordnung von Leistungen zur medizinischen Rehabilitation sind in der Rehabilitations-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses geregelt.
Verordnungsvordrucke
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation werden auf Formular 61 verordnet. Sollen Kinder ihre Mütter oder Väter begleiten, füllen Ärztinnen und Ärzte zudem Formular 65 aus. Der Antrag auf Kostenübernahme für Reha-Sport oder Funktionstraining erfolgt hingegen auf Formular 56.
Hinweise zum Formular 61
Teil A
Um prüfen zu lassen, ob die Krankenkasse für die Rehabilitation zuständig ist, kann Teil A genutzt werden. Auch eine Reha-Beratung für den Versicherten kann bei der Krankenkasse mit Teil A initiiert werden.
Teil B bis D
Auf den Teilen B bis D werden alle notwendigen Angaben für die Verordnung von Leistungen zur medizinischen Rehabilitation gemacht – soweit die Zuständigkeit der Krankenkasse gegeben ist. Formular 61 kann handschriftlich oder am Praxiscomputer ausgefüllt werden. Im letzteren Fall werden die Seiten entweder mit Hilfe eines Vordruckes oder per Blankoformularbedruckung erzeugt. Der Versicherte reicht die vollständig ausgefüllten Unterlagen bei seiner Krankenkasse zur Genehmigung der Leistungen ein.
Teil E
Hier kreuzt der Arzt bei „Erteilte Einwilligungserklärungen“ an, ob der Versicherte der Übermittlung der gutachterlichen Stellungnahme und der Leistungsentscheidung an die Krankenkasse zugestimmt hat. Den unteren Teil der Seite füllt der Versicherte aus und sendet den gesamten Antrag an die Krankenkasse.
Ausfüllhinweise
ICF und personbezogene Kontextfaktoren
ICF
Für das Ausfüllen der Verordnung sind Kenntnisse der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) und des zugrunde liegenden bio-psycho-sozialen Modells der Weltgesundheitsorganisation erforderlich. Sie helfen dabei zu beurteilen, mit welchen Behandlungsoptionen einem Patienten die größtmögliche Chance auf Erhalt oder Wiedergewinnung seiner Teilhabe ermöglicht werden kann. Darauf wird in der Rehabilitations-Richtlinie, die die Verordnung zulasten der Krankenversicherung regelt, aber auch bei der Rentenversicherung ausdrücklich hingewiesen.
Die ICF stellt das konzeptionelle Bezugssystem für die Verordnung von Leistungen zur medizinischen Rehabilitation dar. Mit ihrer Hilfe lassen sich Krankheitsauswirkungen auf der Ebene der Aktivitäten und der Teilhabe (z.B. Immobilität, eingeschränkte Selbstversorgung, soziale Abschottung) beschreiben. Der Einfluss fördernder wie auch hemmender Kontextfaktoren auf die Funktionsfähigkeit und damit Teilhabe eines Menschen kann in ihren negativen (z.B. keine barrierefreien Zugänge, Risikofaktoren wie Bewegungsmangel und Tabakkonsum) wie positiven (z.B. ebenerdige Wohnung, ein unterstützen des soziales und familiäres Umfeld, erfolgreiche Krankheitsbewältigungsstrategien) Facetten dargestellt werden.
Kenntnisse zur ICF werden bei der ärztlichen und psychotherapeutischen Ausbildung oder bei Fortbildungsveranstaltungen vermittelt.
Personbezogene Kontextfaktoren
Personbezogene Faktoren sind in der ICF nicht klassifiziert, sie können aber relevante Einflussfaktoren auf die Funktionsfähigkeit eines Menschen mit Beeinträchtigungen darstellen. Ihre Berücksichtigung ist deshalb bei der Beschreibung der Wechselwirkungen zwischen dem Gesundheitsproblem eines Menschen und seinem Lebenshintergrund auf der Grundlage des bio-psycho-sozialen Modells der Weltgesundheitsorganisation für die Ermittlung individueller Bedarfe und passgenauer Interventionen und Strategien erforderlich.
Abrechnung und Vergütung
Die Verordnung von Leistungen zur medizinischen Rehabilitation wird über die GOP 01611 abgerechnet und die Beantragung einer geriatrischen Rehabilitation über die GOP 01613. Die aktuelle Bewertung der Gebührenordnungspositionen kann im Online-EBM eingesehen werden.
Die Beantragung einer geriatrischen Rehabilitation wird extrabudgetär und damit zu festen Preisen vergütet.
Zuzahlung
Die gesetzliche Zuzahlung für Leistungen zur medizinischen Rehabilitation beträgt 10 Euro pro Kalendertag. Kinder und Jugendliche sind bei Leistungen zulasten der Krankenkassen bis zum 18. Lebensjahr und bei Leistungen zulasten der Rentenversicherung in der Regel bis zum 27. Lebensjahr zuzahlungsbefreit.
Generell gilt: Zuzahlungen sind nur bis zur finanziellen Belastungsgrenze zu leisten. Das sind 2 Prozent der jährlichen Bruttoeinnahmen, bei chronisch Kranken 1 Prozent.
Fortbildungen
Zur Verordnung von medizinischer Rehabilitation bietet die KBV Fortbildungen für Ärzte und Psychotherapeuten an. Diese sind mit jeweils 6 CME-Punkten zertifiziert und werden im Fortbildungsportal angeboten.
Fortbildungsunterlagen
Die Fortbildungen stehen hier zum Download bereit. Die Beantwortung der Multiple-Choice-Fragen und damit der Erwerb von Fortbildungspunkten ist nur im Fortbildungsportal möglich.
Besonderheiten bei geriatrischer Reha
Die Prüfung der medizinischen Erforderlichkeit einer Reha-Verordnung durch die Krankenkasse entfällt, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:
- Die Patientin oder der Patient ist 70 Jahre oder älter.
- Es liegen mindestens eine reha-begründende Funktionsdiagnose und mindestens zwei geriatrietypische Diagnosen vor.
- Es wurden mindestens zwei geeignete Funktionstests als Nachweis der aus den Diagnosen resultierenden Schädigungen durchgeführt.
Eine Übersicht der geeigneten Funktionstests gibt es in Anlage I und eine Liste der geriatrietypischen Diagnosen in Anlage II der Vordruckerläuterungen.
Kinder- und Jugendlichenrehabilitation
Bei der Rehabilitation für Kinder und Jugendliche stehen die Bedürfnisse des chronisch kranken Kindes im Mittelpunkt. Sie darf nicht mit einer Mutter-/ oder Vater-Kind-Kur der gesetzlichen Krankenversicherung verwechselt werden, bei der es sich um eine Leistung für Eltern handelt.
Zielgruppen sind Kinder und Jugendliche, bei denen durch chronische Erkrankungen Einschränkungen der Leistungsfähigkeit, der Lebensqualität und der sozialen Integration – nicht nur kurzfristig – eingetreten oder zu befürchten sind. Ziel der Rehabilitation ist eine Besserung der Leistungsfähigkeit in Schule und Alltag sowie die nachhaltige Sicherung der Lebensqualität und der späteren Erwerbsfähigkeit.
Typische medizinische Indikationen einer Rehabilitation bei Kindern und Jugendlichen sind zum Beispiel Hauterkrankungen wie Neurodermitis, Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes mellitus oder auch Sprachentwicklungs- oder Verhaltensstörungen. Damit die Krankheitsverläufe möglichst abgemildert werden und die Krankheitsfolgen nicht bis ins Erwachsenenalter bestehen bleiben, müssen sie rechtzeitig behandelt werden.
Für Kinder und Jugendliche mit chronischen Krankheiten – insbesondere bei zusätzlichen Risikofaktoren und Komorbiditäten – bietet die Deutsche Rentenversicherung eine stationäre Rehabilitation an.
Reha-Sport und Funktionstraining
Reha-Sport und Funktionstraining kommen für behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen in Betracht. Reha-Sport soll die Ausdauer und Kraft stärken und die Koordination und Flexibilität verbessern. Mit dem Funktionstraining sollen die Beteiligten möglichst dauerhaft in die Gesellschaft und das Arbeitsleben eingegliedert werden.
Wie diese Leistungen erbracht werden, wer sie anbietet und welche Qualitätsstandards einzuhalten sind, ist in einer Rahmenvereinbarung festgelegt. Diese wird zwischen den Krankenkassen und den Leistungserbringern, zum Beispiel Sportvereine oder Reha-Zentren, geschlossen. Sie dient dazu, die Versorgung der Versicherten im Bereich Reha-Sport und Funktionstraining zu sichern und zu standardisieren.
Fragen und Antworten